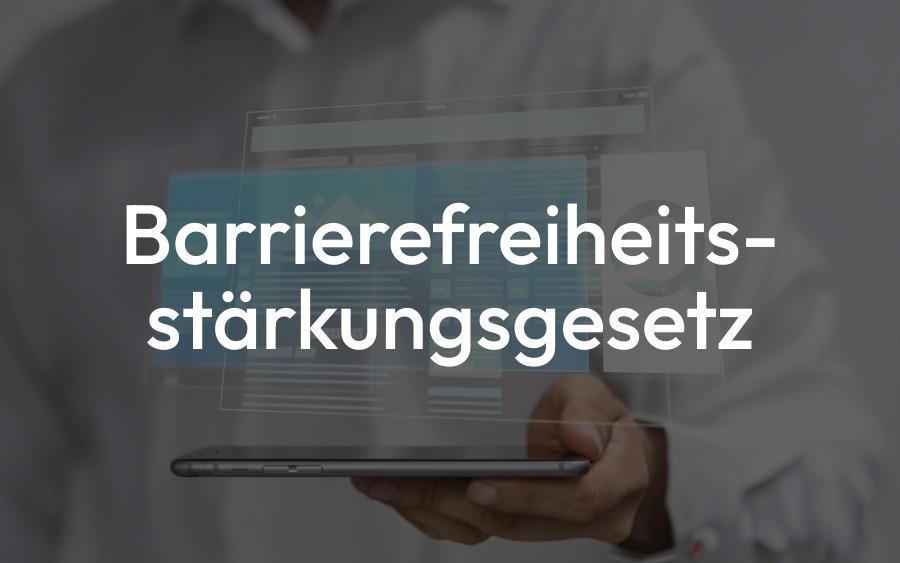Vollständige Episode anhören:
Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, kurz BFSG, klingt sperrig – ist aber ein zentrales Thema für alle, die digitale Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Ziel des Gesetzes ist es, die digitale Teilhabe für alle Menschen zu verbessern – unabhängig von körperlichen oder kognitiven Einschränkungen, Alter oder Medienerfahrung.
Das BFSG ist ein EU-Gesetz und gilt ab dem 28. Juni 2025 verbindlich. Es betrifft vorrangig Unternehmen, die bestimmte digitale Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Doch auch wer nicht rechtlich verpflichtet ist, profitiert davon, sich mit barrierefreiem Design auseinanderzusetzen – nicht nur aus ethischen, sondern auch aus SEO- und UX-Perspektive.
Wer ist betroffen?
Unternehmen müssen das Gesetz in der Regel umsetzen, wenn sie:
- mehr als 10 Mitarbeitende haben
- mehr als 2 Millionen Euro Jahresumsatz erzielen
- bestimmte Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die im Gesetz genannt sind
Zu den betroffenen Produkten zählen unter anderem:
- Selbstbedienungsterminals (z. B. Check-in-Automaten, Geldautomaten)
- Computer, Betriebssysteme und Mobiltelefone
- E-Book-Reader, Smart-TVs und andere interaktive Geräte
- Telekommunikationsgeräte und -dienste
- Online-Shops, sofern sie die oben genannten Produkte oder digitale Dienstleistungen vertreiben
Aber: Auch Kleinstunternehmen müssen das BSG beachten, wenn sie solche Produkte selbst herstellen oder vertreiben – unabhängig von Umsatz oder Teamgröße. Das heißt, wer beispielsweise interaktive Terminals entwickelt, ist zur Barrierefreiheit verpflichtet, auch wenn er oder sie nur zu zweit arbeitet.
Wer ist nicht betroffen?
Nicht verpflichtet sind:
- Unternehmen mit unter 10 Mitarbeitenden und unter 2 Millionen Euro Jahresumsatz
- Anbieter, die keine der gesetzlich erfassten Produkte oder Dienstleistungen anbieten
Dennoch lohnt sich auch für diese Gruppen, freiwillig auf barrierearme Angebote zu setzen – aus Gründen der digitalen Zugänglichkeit, Inklusion und Nutzerfreundlichkeit.
Was bedeutet digitale Barrierefreiheit konkret?
Digitale Barrierefreiheit bedeutet, dass Inhalte für alle Nutzer*innen zugänglich und bedienbar sind – unabhängig von Einschränkungen. Dazu gehören:
- Korrekte HTML-Struktur mit sinnvoller Überschriften-Hierarchie (H1–H6)
- Aussagekräftige Alternativtexte für Bilder (Alt-Tags) und Titel
- Sprechende Links und Buttons, die klar machen, wohin sie führen
- Klare Sprache mit kurzen, verständlichen Sätzen (z. B. Gunning-Fog-Index <10)
- Hohe Farbkontraste und Verzicht auf problematische Farbkombinationen wie Rot-Grün
- Tastaturbedienbarkeit für Navigation und Formulare (Tabulator-Navigation)
- Untertitel und Transkripte für Videos
- Barrierefreie Cookie-Banner
- Zugängliche PDFs und Dokumente
- Optional: eine Seite in einfacher Sprache, die das Angebot zusammenfasst
Technische Aspekte und Empfehlungen
- Strukturierte Inhalte verbessern nicht nur die Zugänglichkeit, sondern auch die Suchmaschinenplatzierung.
- Tools wie Kontrastchecker oder Screenreader-Simulationen helfen bei der Bewertung.
- Der sogenannte Mediopunkt (·) kann helfen, Begriffe sinnvoll zu verbinden, ohne dass Screenreader das Minuszeichen vorlesen.
- WordPress-Themes wie Divi oder Astra unterstützen bereits viele barrierefreie Funktionen, dennoch sollten sie aktiv geprüft werden.
- Newsletter sollten ebenfalls barrierearm gestaltet werden – ohne rein grafische Inhalte, mit klarer Struktur und lesbarer Sprache.
Typische Fehlerquellen
- Logos und Menüeinträge, die redundant zur Startseite verlinken – für Screenreader bedeutet das doppelte Informationen.
- Farbkontraste, die zwar „ästhetisch schön“, aber nicht barrierearm sind – etwa weiße Schrift auf Gold oder Petrol.
- Videos ohne Untertitel oder Transkripte
- Verwirrende Linktexte wie „hier klicken“, ohne Kontext
- Formulare ohne klare Labels oder fehlerhafte ARIA-Zuweisungen
Was sich durch das BFSG verändert – und was nicht
Das BFSG wird keine sofortige Abmahnwelle auslösen – ähnlich wie bei der DSGVO ist mit Einzelfällen zu rechnen, aber nicht mit massenhaften Verfahren. Dennoch gilt: Wer betroffen ist und nicht umsetzt, riskiert empfindliche Strafen (bis zu 100.000 Euro) oder im schlimmsten Fall Einschränkungen im Geschäftsbetrieb.
Das Gesetz schärft das Bewusstsein für digitale Teilhabe – und gibt klare Kriterien vor. Gleichzeitig bleibt viel Interpretationsspielraum, etwa in Bezug auf Kleinstunternehmen oder Mischformen.
Warum Barrierefreiheit mehr als nur Pflicht ist
Digitale Barrierefreiheit ist kein reines Pflichtthema, sondern eine Frage von Haltung und Verantwortung. Sie ermöglicht nicht nur Menschen mit Einschränkungen den Zugang zu Angeboten, sondern schafft auch klarere, nutzerfreundlichere Erlebnisse für alle.
Viele Maßnahmen lassen sich schrittweise umsetzen – und verbessern nebenbei die Usability, die Auffindbarkeit und die allgemeine Qualität digitaler Inhalte.